Mal eben die Sklaverei abschaffen? Und noch ein gespaltenes Land vereinen? Was für eine Herkulesaufgabe. Hat trotzdem immer eine nette Anekdote auf den Lippen: Abraham Lincoln.
Lincoln (2012) – Die Story
Drehbuch: Tony Kushner
Gegen Ende des Amerikanischen Bürgerkrieges sind die Nordstaaten zwar auf Siegkurs, die schwerste Aufgabe steht deren Präsident Abraham Lincoln (Daniel Day-Lewis) aber noch bevor. Er möchte per Verfassungszusatz die Sklaverei verbieten. Doch die davor benötigte Zwei-Drittel-Mehrheit im Repräsentantenhaus muss gegen viele Widerstände erst einmal mühsam erkämpft werden.
Die Einführung von Abraham Lincoln
Es ist ein nasskalter Abend im Lager der Nordstaaten-Armee. Bevor sie zur Schlacht aufbrechen sprechen zwei schwarze Soldaten den auf einem Stuhl sitzenden Präsidenten Abraham Lincoln an. Einer von ihnen, Corporal Clark, weißt Lincoln auf einige Ungerechtigkeiten hin. Zum Beispiel, dass schwarze Soldaten weniger Geld erhalten. Und auch nicht wirklich im Rang aufsteigen können. Lincoln hört aufmerksam zu. Kurz darauf gesellen sich zwei weiße Soldaten dazu, die Lincoln gegenüber stolz dessen berühmte Rede von Gettysburg zitieren. Bis sie schließlich zu ihren Einheiten gerufen werden. Corporal Clark bleibt dagegen noch kurz stehen und zitiert mit leuchtenden Augen auch noch den Schluss von Lincolns Rede. Dann geht er von dannen und Lincoln blickt ihm nachdenklich hinterher.
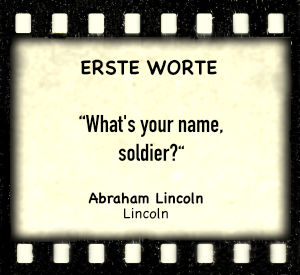
Die Analyse
Zurückhaltung ist eine Tugend. Sieht man bei der Charaktereinführung aber nicht immer so. Vor allem bei der Hauptfigur. Die ist ja schließlich auch unser Held. Und sollte ja eigentlich auch im Mittelpunkt stehen. Auf der anderen Seite sollte eine Einführung ja im Idealfall auch den Charakterzügen der Figur gerecht werden. Was aber, wenn man seine Figur als bescheiden und altruistisch porträtieren möchte? Und gleichzeitig doch eben irgendwie hervorheben will? Wie man das elegant lösen kann zeigt uns das Porträt eines amerikanischen Präsidenten.
Bevor unser guter Lincoln eingeführt wird, betreibt der Film erst einmal Geschichtsunterricht. Mit Hilfe von Fotos und Texteinblendungen. Die Sklavenfrage wird als politisches Dilemma und Auslöser des amerikanischen Bürgerkrieges definiert. Und damit schon einmal der thematische Unterbau für die Motive unserer Hauptfigur etabliert. Bevor diese dann schließlich die Bühne betritt. Dieser erste Auftritt kommt gänzlich unaufgeregt daher. Und passt gerade deswegen so wundervoll zu der Figur des Abraham Lincoln in diesem Film.

Ein passiver Protagonist
Wir erleben Lincoln nämlich in dieser ersten Szene vor allem als eines: einen passiven Zuhörer. Die Kamera beginnt auf zwei schwarzen Soldaten, die Lincoln von ihren Erfahrungen im Krieg erzählen. Erst ganz langsam zieht die Kamera auf und gibt dann zumindest einen Blick auf den Hinterkopf unseres Präsidenten frei. Der Fokus liegt aber weiterhin auf den beiden Soldaten und deren Aussagen. Der Präsident als Beiwerk? Läuft hier irgendetwas falsch bei der Einführung der Hauptfigur? Ganz im Gegenteil.
In „Lincoln“ entscheidet man sich dafür, den Präsidenten vor allem als eine Art väterlichen Freund einer ganzen Nation zu porträtieren. Und genau dafür findet der Film bei dessen Einführung die richtigen Bilder – und Worte. Denn Lincoln macht vor allem zwei Dinge in den nächsten Minuten: er hört zu und stellt Fragen. „Wie heißt ihr“, „Wie lange seit ihr schon im Dienst“ – Lincoln zeigt ehrliche Neugier und Interesse an seinen Untergebenen. Und schiebt auch mal ein kleines Lob à la „tapfer gekämpft, Jungs“ mit rein. Vor allem aber läßt er die Soldaten reden und nimmt sich die Zeit ihnen zuzuhören.

Wie Vater und Sohn
Die Geduld und das Verständnis von Lincoln werden vor allem dann deutlich, als einer der beiden schwarzen Soldaten direkt Kritik an der Behandlung der Afroamerikaner äußert. Lincoln stoppt ihn nicht. Stattdessen nimmt er alles ruhig zur Kenntnis. Auch als der Soldat sich immer weiter in Rage redet. Das Ganze hat etwas von einem wütenden Kind, welches dem Vater sein Leid klagt. Es ist spannend die Reaktion von Lincoln auf diese emotionale Anklage zu beobachten. Er gibt den verständnisvollen Vater, bezieht am Ende aber nicht etwa Position. Nein, stattdessen stellt er weiter Fragen und lenkt das Gespräch geschickt in eine andere Richtung, um die Stimmung zu entschärfen und seinen „Sohn“ zu besänftigen.
Das Gefühl, dass wir hier einer Art Vater-Sohn Konversation zuhören wird auch noch geschickt visuell verstärkt. Leicht erhöht sitzt Lincoln auf einer kleinen Bühne und blickt auf die vor ihm stehenden Soldaten herunter. Aufgebrachter junger Mann trifft auf weisen alten Mann. Und dieser weise Mann nutzt dann geschickt Humor, um die angespannte Situation aufzulockern. Ein paar Gags über die eigene Frisur und schon ist die Schärfe der Situation passé. Mit Humor und kleinen Anekdoten das Umfeld auf seine Seite ziehen zu können wird im weiteren Verlauf des Filmes eine der markantesten Eigenschaften von Lincoln werden. Und hier schon einmal angedeutet.

Charakteraufbau aus fremdem Munde
Am treffendsten für die Motive und den Charakter der Figur ist dann aber wohl die dann folgende Situation. Als zwei weiße Soldaten dazustoßen widmet sich Lincoln ganz diesen beiden. Und fährt hier die gleiche Taktik: Fragen stellen und einfach nur zuhören. Zwei weiße Soldaten links von ihm, zwei schwarze rechts von ihm – und er versucht beiden gleich gerecht zu werden und keinen zu bevormunden. Ein perfektes Bild für diese Figur und seine Mission, aus weiß und schwarz eine einzige Nation zu formen.
Wir erfahren aber noch viel mehr über Lincoln und zwar mit der Hilfe eines kleinen dramaturgischen Kniffes. Einer der beiden weißen Soldaten outet sich nämlich als Fanboy und beginnt Auszüge aus Lincolns wohl berühmtester Rede zu zitieren. Und das ist gleich in mehrerer Hinsicht eine clevere Idee des Drehbuchautors. Einmal hebt man mit dieser extern geäußerten Bewunderung natürlich die Figur des Abraham Lincoln auf ein Podest. Gleichzeitig erfährt man durch die Rede aber auch etwas über die politischen Motive – und damit noch mehr darüber, was Lincoln antreibt. Und nicht etwa aus dessen eigenem Mund, sondern von außen. So kommt das ganze weniger forciert oder gar selbstbeweihräuchernd rüber. Und natürlich spricht dann wiederum auch die Reaktion Lincolns darauf Bände.

Bescheidenheit ist eine Tugend
Dadurch, dass ein Soldat nun auf einmal Lincoln zitiert hat sich ja der Fokus verschoben. Vorher lag er bei den Soldaten, nun auf einmal steht Lincoln im Mittelpunkt. Und genau das liegt ihm nicht. Höflich bedankt sich Lincoln und versucht abzuwiegeln. Mehrmals. Diese Bescheidenheit zahlt natürlich auf das Sympathiekonto der Hauptfigur beim Zuschauer ein. Und das der Soldat sich nicht stoppen läßt erhöht die Bewunderung für die Worte Lincolns nur weiter. Getoppt wird das ganze dann aber noch im Anschluß. Die Soldaten müssen aufbrechen und Lincoln erhebt sich bereits von seinem Stuhl, als der kritikfreudige schwarze Soldat vom Beginn sich noch einmal an ihn wendet. Und nun ebenfalls die Rede Lincolns zitiert.
„Auf dass diese Nation, unter Gott, eine Wiedergeburt der Freiheit erleben“ wird – mit diesen Worten wird am Ende der Einführung dann auch gleich einmal die Mission von Lincoln perfekt auf den Punkt gebracht. Und wieder agiert Lincoln hier einfach nur als genauso verständnisvoller als auch nachdenklicher Zuhörer. Und das Bild, wie beide sich gegenüberstehen, mit dem etwas erhöht positionierten Lincoln, hat schon fast etwas von einem Jünger der fasziniert Jesus zitiert. Dank dem kleinen Kniff mit der Rede wird so einerseits Lincoln auf ein hohes Podest gehievt, während er gleichzeitig eben doch unglaublich bescheiden und sympathisch daherkommt. Understatement und Grandeur in einer Szene. Ein schmaler Grat, den diese Einführung aber nahezu perfekt meistert. Für den Vater einer ganzen Nation ein wahrlich würdiges Intro.